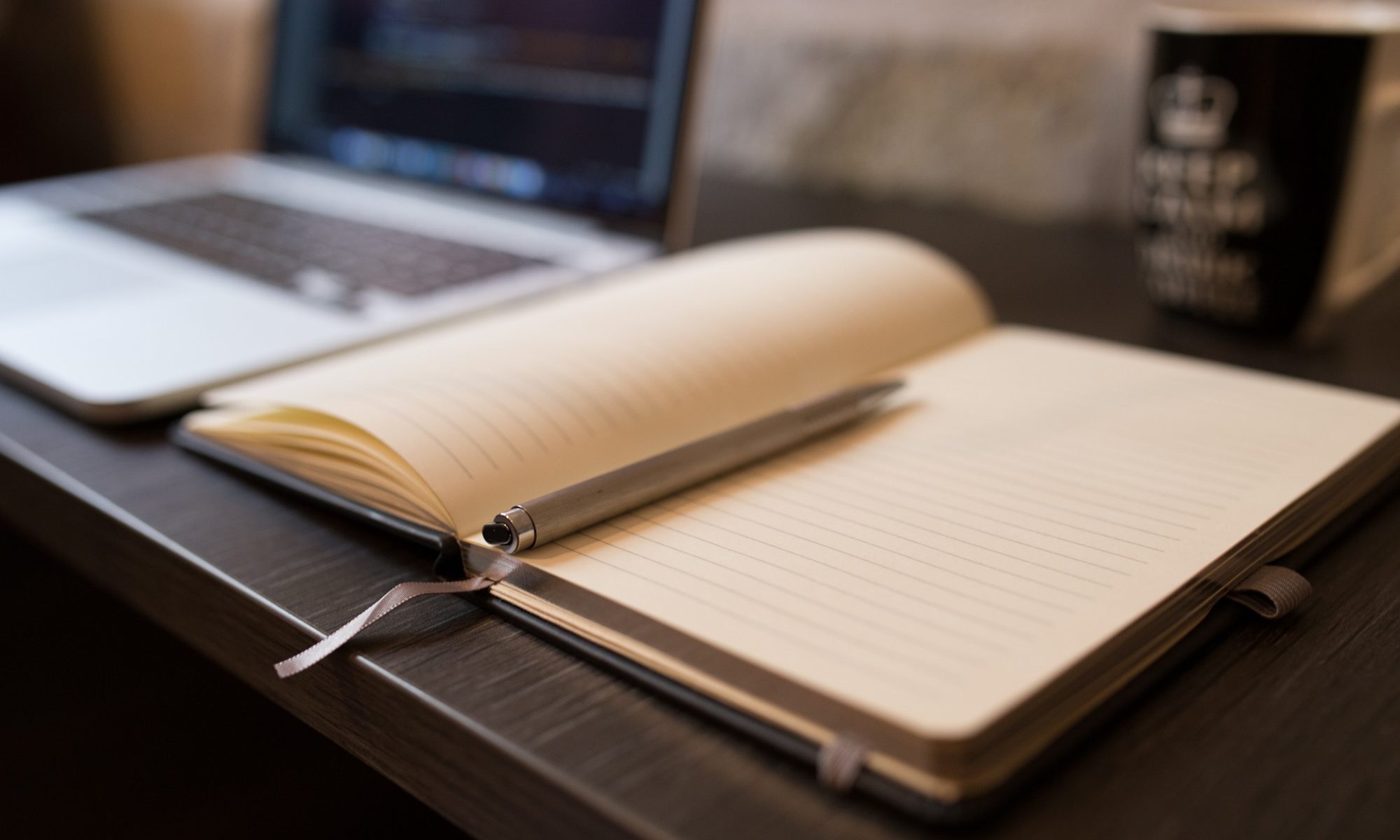Die europäische Philosophie schätzt das Einzelne nicht. Verblendet von der Macht der Sprache, die das nicht greifbare Allgemeine im Begriff zu fassen vermag, verwechselt die Philosophie seit jeher das Begreifen eines Einzelnen mit dessen Sein. So missrät ihr jeder Blick auf das Seiende zu dem Blick in ein Wörterbuch.

Was aber ist das Sein? Es ist die Absonderung eines Einzelnen aus dem Gewebe der Welt. Das Seiende ist das Abgesonderte. Die Absonderung aber braucht Kraft, um zu geschehen und um fortzubestehen. Diese Kraft wirkt sowohl nach außen, indem sie alles, was nicht zu dem Einzelnen gehört, abstößt, wie auch nach innen, indem sie dessen Teile zusammenhält. Das Seiende ist also nicht selbstverständlich, sondern bedingt.
Skip those paragraphs if you like, you better do
Parmenides überschätzte das Allgemeine so sehr, dass es ihm zu einem Einzelnen wurde. Heraklit unterlag einem ähnlichen Fehler, indem er das Einzelne so überschätzte, dass es ihm zu dem Allgemeinen wurde. Weil sich aber beide offensichtlich darauf beschränkten, das Problem des Seins, nicht des Erkennens, lösen zu wollen, mussten ihre irrigen Ansätze der Bedeutungslosigkeit verfallen, sobald Platon die untrennbare Verknüpfung des Erkennens und des Seins in die Philosophie einprägte.
Der Vorrang des Allgemeinen vor dem Einzelnen ist bei Platon bekanntlich so groß, dass die Herausbildung eines Einzelnen aus dem Gewebe der Welt, das Werden von etwas, ihm als Verlust von Wirklichkeit gilt. Das Allgemeine ist wirklich Seiendes, das Einzelne nur dessen stets mangelhafter und flüchtiger Abklatsch. Was aber für das Erkennen zutrifft, dass jedes Einzelne vor dem Hintergrund der Welt nur hervortritt, wenn es sich als besonderer Fall eines Allgemeinen darbietet, stimmt für das Sein nicht. Seiendes entsteht aus Kraft, nicht aus einer allgemeinen Form. Die von außen und erst im Nachgang des Werdens erkennbare Form eines einzelnen Körpers ist ja gerade im Wechselspiel zwischen jener Kraft und den Einflüssen der Welt entstanden.
Diese Verkehrung der Verhältnisse behielt über Jahrhunderte ihre Gültigkeit. Mochte Aristoteles auch Einwände gegen Platons allzu schlichte Konzeption vom Verhältnis des Allgemeinen und des Einzelnen haben, so ließ er es dennoch an der notwendigen Entschlossenheit und Schärfe fehlen, um den ontologischen Vorrang des Individuums zu etablieren.
Erst die Nominalisten waren es, die einen mächtigen Einspruch gegen die Platonische Verkehrung der Verhältnisse einlegten. Unter ihnen ragt Wilhelm von Ockham hervor, der überhaupt erst wieder auf die Verknüpfung von Erkennen und Sein aufmerksam macht und sie auf dieser Grundlage dann auch kritisiert.
Und doch! Indem Kant das empirisch Seiende den Bedingungen des Erkennens unterwarf, schloss er nicht nur – wie schon Ockham – das Selbstwidersprüchliche aus dem Bereich des Seienden aus, sondern auch das Regelwidrige.
Was also bleibt dem Menschen, um sich seiner Individualität zu vergewissern? Anstatt sich radikal als Individuum, als Einzelner im Sinne Max Stirners zu verstehen, versteht er sich zunächst als Gattungswesen, verschüttet so seine Individualität und muss sie dann durch überflüssige Vergleiche mit anderen rekonstruieren.