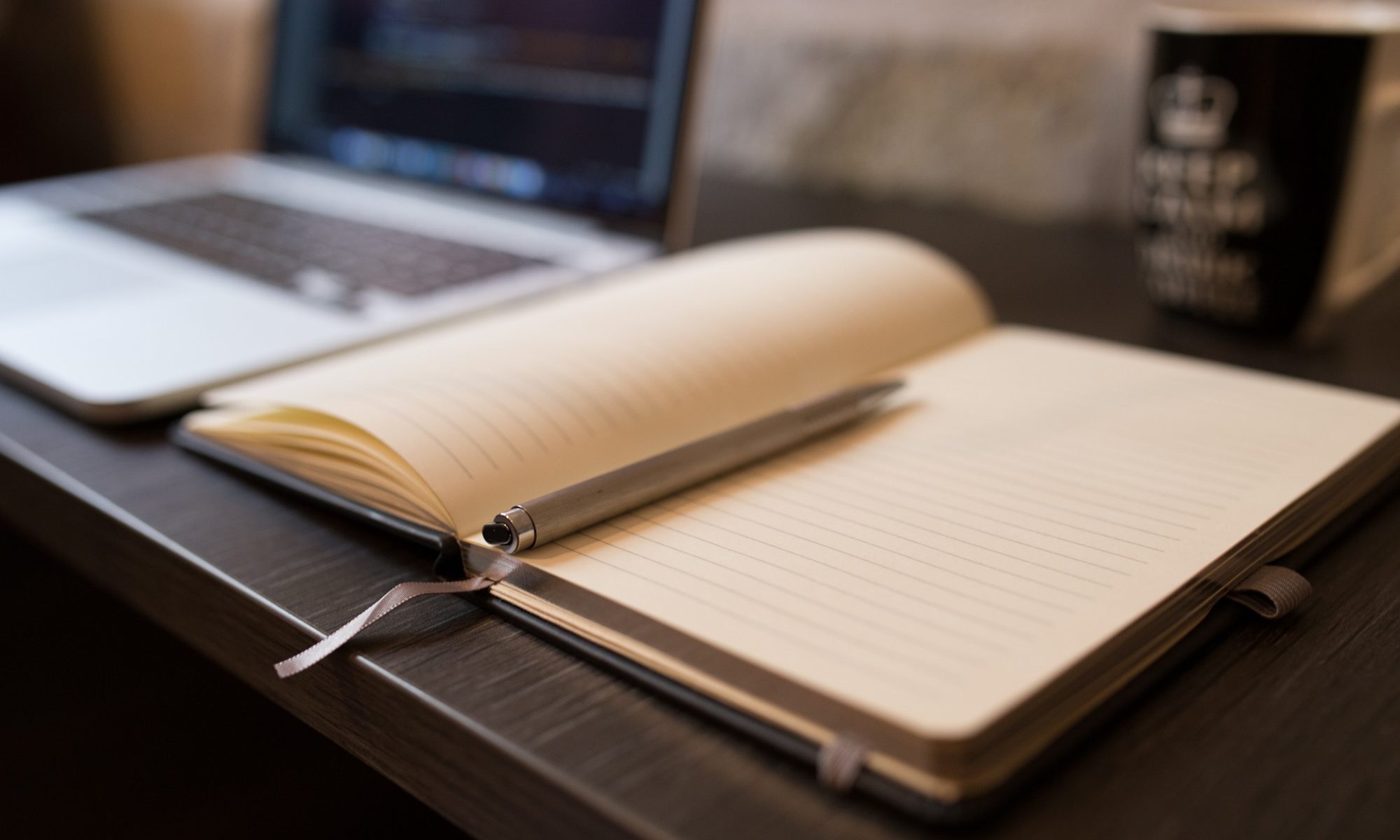Auf das Verhältnis von Ursache und Wirkung werden wir im Alltag erst dann aufmerksam, wenn die Dinge nicht so verlaufen, wie wir es erwarten: „Verflixt, warum funktioniert das jetzt nicht?“ oder „Mist, was ist da nur schief gegangen?“ sind typische Ausrufe in solchen Situationen, mit denen wir mehr oder minder bewusst nach einer Ursache fragen.

Warum ist das Regal mitsamt der teuren Porzellanvase umgestürzt? Wir wollen die Ursache herausfinden, um „bei dem nächsten Mal“ einen Sturz zu vermeiden. Denkbare Antworten auf unsere Frage lauten:
- Das Regal ist umgestürzt, weil es nicht an der Wand verankert worden ist.
- Es ist umgestürzt, weil es überhaupt aufgestellt worden ist.
- Es ist umgestürzt, weil wir ein Buch zu viel hineingestellt haben.
Intuitiv ist die erste Antwort am aussagekräftigsten, um zukünftige Stürze zu vermeiden und damit unseren Absichten zu dienen. Der entsprechende Grund, also das Unterlassen einer sachgerechten Verankerung, ist etwas, das durchaus in unserer Macht liegt. Es ist derjenige Grund, den wir vermutlich als „Lehre“ aus dem Unfall und seiner gedanklichen Aufarbeitung ziehen sollten.
Allerdings ist es nicht unbedingt der Grund, welcher dem zu erklärenden Ereignis des Sturzes zeitlich und räumlich „am nächsten“ lag. Diesen Vorzug hat die Erklärung mit dem überzähligen Buch. Sie erfüllt die drei Kriterien, welche David Hume1Abstract of the Treatise of Human Nature: http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/hume1740.pdf an eine kausale Verknüpfung zwischen A (Ursache) und B (Wirkung) stellt:
- Zeitliche und räumliche Nähe von A und B
- Zeitliche Vorgängigkeit von A vor B
- Konstante Verbindung von A-artigen und B-artigen Ereignissen

Eine der Schwierigkeiten mit Humes Reduktion der Kausalität auf die drei Faktoren „contiguity, priority and constant conjunction“ ist zu bestimmen, was genau A-artige Ereignisse sind. Üblicherweise erleben wir in einem Menschenleben nur so wenige Stürze von Regalen oder Schränken, dass die geforderte konstante Verbindung zwischen dem Auflegen eines Buches und dem Sturz rein quantitativ nicht besteht; vielmehr gehen wir schon bei einem einzigen Sturz eines Schrankes, also ohne einschlägige Vorerfahrungen, davon aus, dass das Auflegen des Buches ursächlich dafür war. Die von Hume geforderte konstante Verbindung lernen wir also nicht zwischen Büchern und Schränken, sondern zwischen allgemeineren Arten von Ereignissen kennen, z. B. zwischen dem Auflegen irgendeiner Masse auf einen Körper in einem labilen Gleichgewicht und dessen Umkippen.
Was jedoch macht das Ereignis A zu einem A-artigen Ereignis? Anders gefragt: Warum führt nicht jedes riskante Auflegen eines Buches zum Umkippen? Boden- und Sockelbeschaffenheit, Wandverankerung, Lastverteilung und Schwung dürften Faktoren sein, die das Umkippen mitbestimmen. Was soll, angesichts so vieler Faktoren, die Rede von einem „A-artigen“ Ereignis? Ob ein Ereignis A‘ tatsächlich A-artig ist oder nicht, lässt sich kaum prognostizieren, sondern nur ex post am Ergebnis ableisen. Dann aber ist das Hume’sche Kausalitätskriterium zirkulär und damit hinfällig: Kausalität wird auf constant conjunction zurückgeführt, die Glieder jener conjunction lassen sich aber nur an Kausalität ablesen.