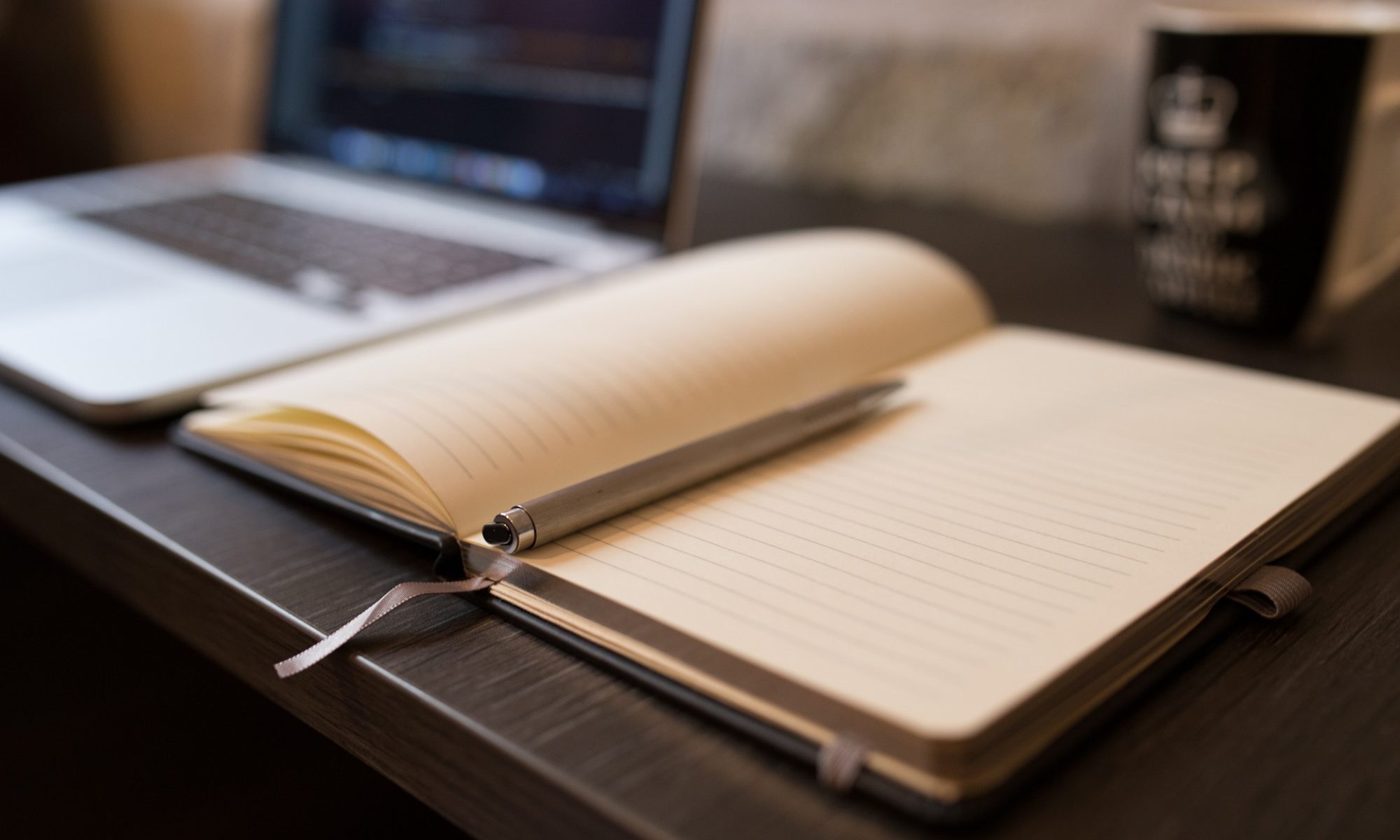Was macht den Menschen fähig zur Kooperation?
Yuval Noah Harari1In: 21 Lessons for the 21 Century, chapter 17 („post-truth“), p. 272 verdanke ich die Einsicht, dass es Geschichten sind, die ein künstliches Zusammengehörigkeitsgefühl über die engen Grenzen von Familie und Freundschaft hinaus erzeugen und den Menschen so zur Kooperation befähigen.
Was aber treibt mich überhaupt zur Aktion an, unabhängig davon, ob ich sie mit anderen gemeinsam oder allein durchführe? Sagen wir, einen neuen Schlauch in einen Fahrradreifen einzuziehen. Es ist die Geschichte, die ich mir selbst bei der Handlungsplanung erzähle. Was macht diese Geschichte glaubwürdig und motivierend? Die kausalen Verknüpfungen in ihr, mithin die Vorstellung, dass meine spezifische Einwirkung auf die Welt zu dem gewünschten Zustand führen muss.

Geschichten spielen auch eine Rolle bei dem Aufbau eines Selbstbildes. Albert Camus stellt in dem Roman „La chute“2Diesen Roman gelesen zu haben, kann ich leider nicht für mich beanspruchen; ich referiere hier die unterhaltsame Zusammenfassung, die Stephen West in seinem Podcast „Philosophize This!“ gegeben hat. dar, dass die Erschütterung dieses Selbstbildes einen Menschen stärker treffen kann als eine drastische Verschlechterung seiner objektiven Lebensumstände. Die Fiktion wiegt schwerer als die Realität, und das, obwohl wir Menschen physiologisch so sehr darauf angewiesen sind, dass in der Realität die Bedingungen unseres Weiterlebens und Wohllebens erfüllt sind.
Es dürfte also unmöglich sein, einen Menschen zu verstehen, ohne die Geschichten zu berücksichtigen, die er sich selbst über seine Handlungen und über seine eigene Person erzählt.
Diese fundamentale Bedeutung von Geschichten führt zu der Einsicht, dass auch die Kausalität eine Geschichte ist. Erst durch die Sprache geraten Antezedens und Konsequenz in den Zusammenhang, den wir als Kausalität kennzeichnen.
Further thoughts on that issue: The human being as a Bayesian predictor
Der Mensch begreift sich selbst und das Universum. Er fasst beides in Begriffen. Er weiß sowohl, dass er dem Universum gedanklich gegenüber steht, als auch, dass er tatsächlich aus dem Universum entstanden und somit ein Teil dessen ist. Er kann aber weder die Entstehung des Universums selbst noch seine Entstehung als die eines Wesens, welches zu diesem Verständnis fähig ist, erklären. Die Erklärung des ersteren würde einen Standpunkt außerhalb des Universums erfordern und ist deshalb unmöglich, die Erklärung des letzteren scheitert daran, dass …
Kausalität, also regelmäßige Zusammenhänge oder Abfolgen zu erkennen, ist der Mensch aufgrund seines Verstandes in der Lage. Denn der Verstand ist unter anderem eine Maschine zur Erzeugung statistischer Vorhersagen. Diese Vorhersagen fließen in die Wahrnehmung der Welt und in die Handlungsplanung ein.
Critique of Hume
The easiest case of causation is probably the example adduced by David Hume: One billard ball is hitting a second one, which is hitherto resting, and causes it to roll off. Hume, as is well known, argued that in watching these events we cannot avoid to understand the hitting of the balls, which we’ll call the event ec, to be the cause of the movement of the second ball, which event we’ll call ee. Although this relationship of cause and effect seems inevitable, Hume argued that our perception of it is in fact a misconception, as all we actually do perceive is a succession of events ec and ee, not its causal conjunction.
This is, of course, true. And yet it fails to take into account our intimate acquaintance with exactly this kind of mechanical causation: From early on, we are accustomed to push things or move them around. We know the feeling of exercising force on an object and the inertia of it that must be overcome, and we equally well know the feeling of being pushed. Thus when watching one object being pushed by another, we as young children probably generalize from our own experiences and the scene we behold to a general concept of mechanical force; later on, we get to know other types of force, so that we can form an even more general and abstract concept of causation.
Yet, as the word „apple“ is a generalisation of many concrete apples, and „fruit“ is a generalisation of many species of fruit, so „causation“ is nothing but a generalisation. On reflection, we know generalisations only take us so far. If a1 and a2 and a3 share common traits P1 and P2 and P3, so that we subsume them under a species A, it’s fair to predict that o1, having also the traits P1 and P2, will be of A and thus have trait P3, too. That’s a sound and rational assumption, but nothing guarantees that it will be like this.

With causalities, it’s also sound and rational to expect that ceteris paribus from similar causes similar effects will occur. The predictive value of an established regularity in the natural sciences is much higher than that of pure guesswork, and yet, on reflection, we are well advised to acknowledge that it’s not as high as the absolute certainty which we can achieve in the demonstrable sciences, mathematics, geometry and logic. Still, regularities are the best tool we have for understanding, manipulating and predicting the outside world. To doubt them for no reason means to compel oneself to idleness, as we then have no way to predict the outcome of any action.
The question at this point is: Why didn’t this degree of certainty – considerably more than zero, slightly less than 100 percent – suffice for the philosophers?