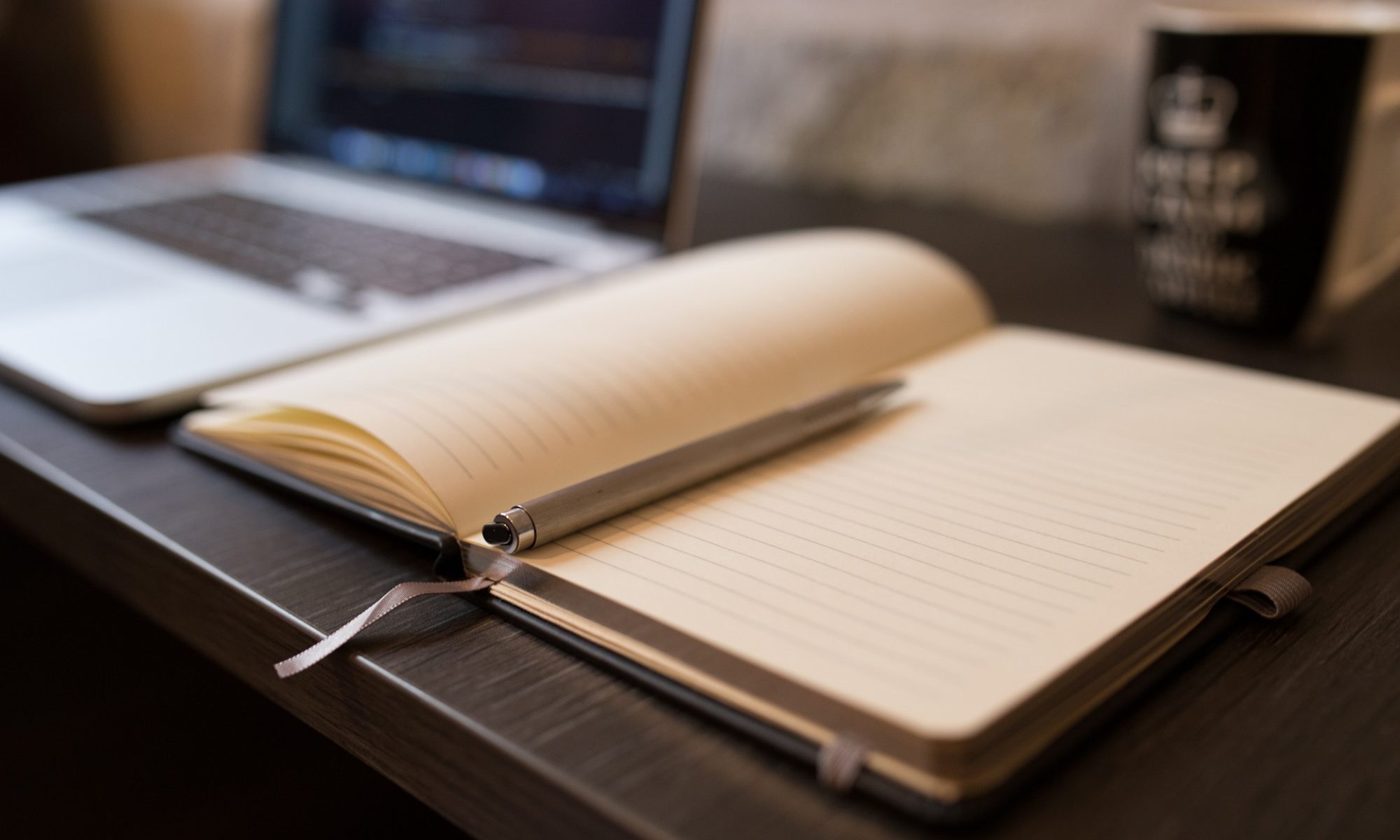Setzen wir voraus, dass die Frage nach der Willensfreiheit und die Suche nach dem Ich beginnen, wenn wir uns mit einer vergangenen Handlung von uns auseinandersetzen. Wir fühlen Reue über diese Handlung und sagen uns, dass wir „so nicht hätten handeln sollen“, oder wir fühlen Genugtuung und sagen uns, dass wir „nicht anders hätten handeln sollen“. In beiden Fällen stellen sich die Fragen, wer das Subjekt, das „Ich“, sei, an das sich jene damaligen Imperative richteten, und wie die damalige Entscheidung zur Handlung zustande gekommen sei.

Die libertarianistische Position
Eine Antwort darauf, die eher der libertarianistischen Position in der Debatte um die Willensfreiheit zuzuordnen ist, zerlegt das Ich in mindestens zwei Teile, die prinzipiell vergleichbar mit den Seelenteilen Platons sind. Typischerweise gibt es dann einen Teil, der zu der moralisch oder pragmatisch schlechter beurteilten Handlungsalternative drängte, und einen Teil mit gegensätzlichen Antrieben. Die Entscheidung wird als Über- oder Unterlegenheit des besseren Teils interpretiert. Bemerkenswert ist auch, dass wir meistens entweder sagen, dass beide Teile unser Ich ausmachen bzw. „in unserer Brust wohnen“, oder dass wir uns vor allem mit dem besseren Teil identifizieren, indem wir sagen, er sei „unser eigentliches Ich“, der „Kern“ unserer Persönlichkeit.
Halten wir fest, dass es bei dieser Antwort zu einer unvermeidlichen Dissoziation des Ich in zwei handelnde, aktive Teile kommt, auch wenn sich letztlich nur ein Teil so durchsetzt, dass daraus eine objektive Handlung folgt. Gleichwohl sind beide Teile in der subjektiven, retrospektiven Selbsterforschung aktiv, da sie um die Entscheidung zur einen oder anderen Handlung ringen.
Die deterministische Position
Ein zweite, konkurrierende Antwort räumt zwar zunächst im Sinne der deterministischen Position ein, dass die Entscheidung zu einer Handlung kausal zwingend aus diversen Antezedenzbedingungen erfolgt sei. Das körperliche Subjekt der Handlung wird dabei als nahtlos in das kausale Gewebe des Weltganzen eingebunden gedacht. Gerade diese Einbindung untergräbt den Anspruch auf die privilegierte Perspektive eines „Ichs“. Gleichwohl ist gerade diese privilegierte Perspektive im subjektiven Erleben ja zweifelsohne gegeben und kann nicht schlichtweg bestritten werden.

So muss es auch bei der zweiten Antwort zu einer Dissoziation des Ichs kommen, wobei hier allerdings ein aktiver, aber naturkausal determinierter Teil gegen einen theoretischen, passiven Teil steht, welcher das Handeln und insbesondere die Konsequenzen des Handelns seines Komplements „erlebt“, sie wohl auch als Teil seines gesamten „Ichs“ zu deuten vermag, aber in letzter philosophischer Strenge eher sagen müsste: „Es handelte in mir“ als „Ich handelte“.
Das Unbehagen in der letztgenannten, deterministischen Interpretation einer Entscheidung, die zu einer verwerflichen, schuldhaften und sanktionierten Handlung führt, rührt nun sicher nicht zuletzt aus dem Gefühl, als erlebendes Ich die Konsequenzen eines von diesem Ich losgelösten, eben dissoziierten und nicht beeinflussbaren Teils des Selbst nicht nur tragen, sondern auch annehmen zu müssen. Ebenso, wie eine ganze Person nicht die Verantwortung für eine Handlung übernehmen will, die ihr von äußeren Kräften aufgezwungen worden ist, mag hier der sich selbst bewusst erlebende Teil des Ichs nicht die Verantwortung für einen anderen Teil übernehmen, der sich zumindest in der philosophischen Reflexion als unbeeinflussbar erweist.
Fraglich ist allerdings, ob dieses Gefühl, welches die Ablehnung des Determinismus zumindest zum Teil motiviert, der Analyse standhalten kann: Wir werden sehen, dass die hier beklagte Dissoziation in den aktiven, aber determinierten und den theoretischen, passiven Teil des Ichs keineswegs eine Besonderheit jener ex post Betrachtung eigenen Entscheidens ist, sondern „eigentlich“ schon immer unserem jeweiligen Welt- und Selbstbezug zugrundelag.
There’s more to it!
Interessant, lesen, einarbeiten: https://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwVariousKane.html